|
|
Über den Vorgänger Pfarrer Gottfried Dümpelmann hatte ja im Vorjahr das
"Käseblättchen" in mehreren Ausgaben berichtet. Bei Dümpelmanns Nachfolger
Johann Daniel Müller (1763 bis 1815) dagegen kann man sich kürzer fassen.
Nur knapp sechs Jahre war er in Deilinghofen, das war die einzige Pfarrstelle,
die der in Voerde geborene Pfarrerssohn innehatte. Anders als bei Dümpelmann
wissen wir bei Müller nicht viel von seiner Theologie und
Frömmigkeitsausrichtung. Und trotzdem lohnt es sich zu schildern, was in
seiner Zeit gegen Ende des 17. Jahrhunderts in Deilinghofen geschah.
Zum Pfarrer ordiniert und eingeführt wurde Müller 28-jährig im Juli 1791,
nachdem er im Frühjahr nach Deilinghofen gekommen war. Spätestens mit seiner
Einführung bezog er das Alte Pastorat. Dieses besondere Haus war in der
Vakanzzeit vor Müllers Einzug von einem gewissen Johann Diedrich Lente bewacht
worden, der dafür auch vom Presbyterium bezahlt wurde (alle Einzelheiten
finden sich in: "Das Alte Pastorat in Deilinghofen und die dortigen Pfarrer
von 1765 bis 1834", Blätter zur Deilinghofer Kirchengeschichte, Heft 3, hg.
von F. Groth, P. Kramme, H. Vicariesmann und H. Korsch-Gerdes, Deilinghofen
1994, S. 132 bis 142).
Kurz nachdem unser Müller nach Deilinghofen kam, passierte im Frühjahr 1792
eine Katastrophe, die hier zu schildern ist und von der wir in schriftlichen
Quellen Zeugnisse haben: von dem Riesenbrand, der in diesem Jahr in
Deilinghofen ausbrach.
Davon gibt in eindrucksvoller Weise die in Deilinghofen zu sehende
Balkeninschrift Zeugnis, auf der man am Hause Ziegenhirt am Balver Weg lesen
kann:
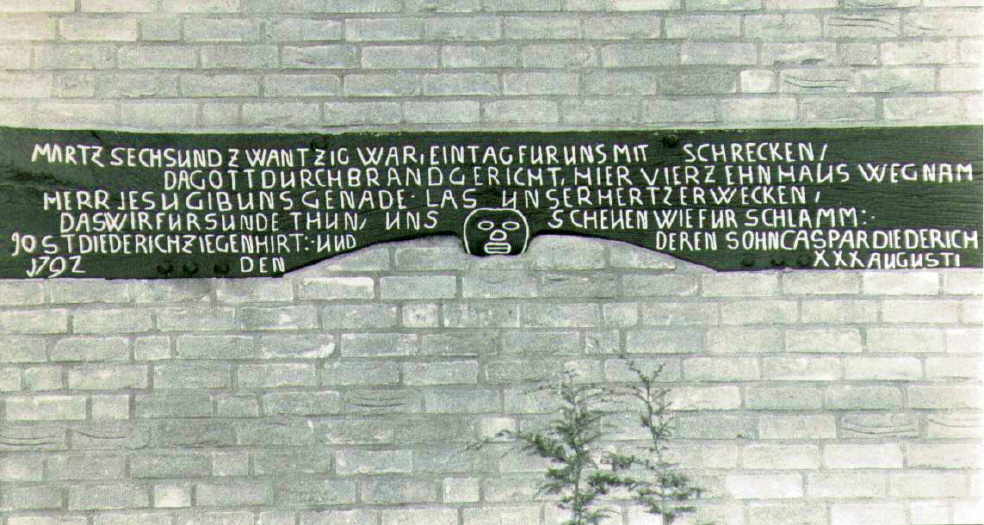
"MARTZ SECHSUNDZWANTZIG WAR, EIN TAG FÜR UNS MIT SCHRECKEN /
DA GOTT DURCH BRANDGERICHT, HIER VIERZEHN HAUS WEGNAHM [/]
HERR JESU GIB UNS GENADE LAS UNSER HERTZ ERWECKEN /
DAS WIR FUR SUNDE THUEN UNS SCHEUEN WIE FUR SCHLAMM:
JOST DIEDERICH ZIEGENHIRT : UND DEREN SOHN CASPAR DIEDERICH
1792 DEN XXX AUGUSTI".
Der 26. März 1792 also war der Tag mit Schrecken, als Flammen 26 Häuser im
Dorf verzehrten; und das Gebet der Ziegenhirts lautet:
"Herr Jesu, gib Gnade, lass unser Herz erwecken, dass wir für Sünde-Tun uns
scheuen wie für Schlamm". Das schrieben im gleichen Jahr am 30. August
Ziegenhirt sen. und jun. wohl angesichts des dann neu errichteten Hauses.
In seiner Autobiographie "Abendglockentöne" beschreibt der aus Iserlohn
stammende Pfarrer und spätere Professor der Theologie und Oberhofprediger
Gerhard Friedrich Abraham Strauß (vgl. zu dessen Leben sehr anschaulich im
Internet
www.gerhard-friedrich-abraham-strauss.de),
dass er als einschneidende Kindheitserinnerung genau den 26. März 1792 nicht
vergessen könne. Da war er ein gerade fünfjähriges Kind und wohnte im
Pfarrhaus seines Vaters
Johann Abraham Strauß in der Iserlohner
Altstadt in der Hardtstraße (Vater Strauß war ja, wie im "Käseblättchen" schon
vorkam, als Pfarrer engstens verbunden mit seinem Busenfreund Pfarrer
Dümpelmann aus Deilinghofens Altem Pastorat). Just zur gleichen Zeit, als in
Deilinghofen das Riesenfeuer wütete, brach die Krankheit der Blattern bei dem
kleinen Jungen aus, und er schildert sein Leiden des schlimmen
Krankheitsausbruchs in den Glockentönen (in der Originalschreibweise) so:
"Es war 1792 am Vorabend des Tages, an dem das Dorf Deilinghofen abbrannte.
Die Bevölkerung von Iserlohn strömte zu dem Hahrhügel, um die Feuersbrunst aus
der Ferne zu beobachten. Die Magd nahm mich auch mit, mußte mich aber bald
zurückbringen, da ich über Unwohlsein klagte. Ich weiß nur, daß ich mich
hernach vor die kleine Thür auf einen Schemel setzte, das Zuströmen der Menge
ansah und nach und nach in den peinlichsten Zustand gerieth, der in Kopfweh,
und einem dumpfen, unleidlichen Drängen der ganzen körperlichen Tätigkeit in
die Haut bestand, in welchem mir war, als wollte das Blut und alle Säfte aus
den Poren heraus."
So schlimm das Unglück war, so hatte der noch "neue" Deilinghofer Pastor
Müller gottlob nach diesem Feuer keine Beerdigungen zu halten. Das Kirchenbuch
belegt, dass bei dem Brand Menschenleben wohl nicht zu Schaden gekommen waren
- ganz im Gegensatz zu einem Brand 1740 bei Schulte-Riemkes.
Vermutlich aufgrund dieser Brandkatastrophe von 1792 wurden noch in Pastor
Müllers Zeiten Lehren für die Zukunft daraus gezogen: Deilinghofen erhielt im
Jahre 1794 seine erste Feuerspritze - sozusagen der 'richtige' Anfang des
Feuerwehrwesens im Ort. Am 22.Juli 1794 schrieb dazu das Landgericht Altena an
das Deilinghofer Presbyterium: Es "ist eine Feuerspritze überhaupt, für das
Dorf selbst sowohl, als auch für die Kirche insbesondere eine nützliche, und
nothwendige Sache, da das Dorf Deilinghofen, von Iserlohn der nächsten Stadt,
beynahe zwey Stunden entfernt ist, und also, bey Feuersgefahr die zur Rettung
erforderliche Spritze immer zu spät ankommen müßte". Nun brauchte man eine
Unterstellmöglichkeit für die erste Spritze.
 Man
nahm das 'Leichenhaus' an der Kirche, womit nichts anderes gemeint ist als der
Vorbau, durch welchen man heute in die Stephanuskirche hineinkommt (vgl. dazu
links die Wikipedia-Abbildung; Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephanuskirche_%28Hemer%29).
Umbaukosten entstanden, die man der 'Armenkasse' entnahm, und die einkommende
Pacht für dieses 'kommunale' Spritzenhaus sollte dann wieder der Armenfürsorge
zugutekommen: zwei Reichstaler pro Jahr. Doch zuerst ließ das Geld auf sich
warten, und schon im Jahre 1800 konnte man die Sache wieder zu den Akten
legen, da man ganz in der Nähe das erste `richtige' Spritzenhaus des Dorfes
gebaut hatte
Man
nahm das 'Leichenhaus' an der Kirche, womit nichts anderes gemeint ist als der
Vorbau, durch welchen man heute in die Stephanuskirche hineinkommt (vgl. dazu
links die Wikipedia-Abbildung; Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephanuskirche_%28Hemer%29).
Umbaukosten entstanden, die man der 'Armenkasse' entnahm, und die einkommende
Pacht für dieses 'kommunale' Spritzenhaus sollte dann wieder der Armenfürsorge
zugutekommen: zwei Reichstaler pro Jahr. Doch zuerst ließ das Geld auf sich
warten, und schon im Jahre 1800 konnte man die Sache wieder zu den Akten
legen, da man ganz in der Nähe das erste `richtige' Spritzenhaus des Dorfes
gebaut hatte
Ein paar Wochen nach diesem schlimmen Brand stand für den jungen Pfarrer die
Hochzeit an. In unserem Kirchenbuch, Abteilung "Verzeichnis der Copulirten ab
1781", berichtete Pastor Müller in eigener Sache:
"1792 d. 22ten May Geh[eiratet] Joh. Dan. Müller, zeitlicher Prediger mit
Cathr. Mar. Feldhoff aus Langerfeld Gerichts Schwelm".
In seinem bemerkenswerten Forscherehrgeiz hat sich der sehr
Deilinghofen-kundige Heimatforscher Herbert Schulte (Iserlohn) die Mühe
gemacht, zusätzlich das Langerfelder Kirchenbuch zu bemühen, um
herauszubekommen, dass das Paar dort dreimal aufgeboten und am genannten
Termin eben am Wohnort der Braut (die eine Tochter des Langerfelder Kaufmanns
Johann Henrich Feldhoff war) getraut wurde.
Im Alten Pastorat wurde bald aus dem jungen Paar eine größer werdende Familie.
Ihnen wurde laut Kirchenbuch am "20.Januar 1793 um 2 Uhr morgens" der Sohn
Johann Carl Müller geschenkt, dann bereits ein Jahr später folgte der zweite
Sohn, der einjährig starb, schließlich als drittes in Deilinghofen geborenes
Kind "am 18.März 1796 morgens um 9 Uhr" Johanna Sophia Maria Müller. Den
zweiten Namen Sophia erhielt das Kind von ihrer Taufpatin "Jungfer Anna Sophia
v. d. Beck[e]" in Sundwig.
Insgesamt sollte dieser Pfarrer Müller zunächst in Deilinghofen und dann in
Langerfeld zwölf Kinder zeugen.
Wenn wir also in den 90er Jahren ins Alte Pastorat blicken, dann war dort
erstmals richtiges Familienleben mit Kinderlachen usw. zu finden, nachdem der
Vorgänger Dümpelmann als Junggeselle ja ohne Nachkommen geblieben war.
Und dann das Frappierende: Wegen "schwacher Brust" ging Müller nach etwa sechs
Jahren von Deilinghofen weg und war dann in Langerfeld - wie angedeutet -
vital genug, weitere weitere Kinder zu bekommen, und wirkte dort weit über ein
Jahrzehnt als Langerfelder Gastwirt.
Von dem zuvor Schwerstkranken, der nun wohl
doch wieder fit für eine zweite Karriere war, schreibt Friedrich Wilhelm Bauks
in seinem Westfälischen Pfarrerbuch, dass Müller eintrat "in das
Kaufmannsgeschäft seines Schwiegervaters", und er wirkte "dort als
Handelsmann, Weinschenker u[nd) Bäckereibesitzer", was der genannte Herbert
Schulte nach dem Langerfelder Kirchenbuch so bestätigt fand: Müller "übernahm
... eine Gastwirtschaft in Langerfeld". Schulte fand diesen Zusatz "Gastwirt"
erst bei den Geburtseintragungen der Müller-Kinder ab 1807, während zuvor in
den Kirchenbüchern bloß "Kaufmann" zu lesen ist.
Kaufmann und Gastwirt ist sogar untertrieben: dieser Mann mit dem
Durchschnittsnamen Müller war alles andere als ein Durchschnittstyp: Es gibt
eine heimatgeschichtliche Doktorarbeit von Günter Voigt (Bochum 1994), in der
unser Müller gewürdigt wird als eine kommunal hochwichtige Persönlichkeit und
als der erste Bürgermeiser von Langerfeld in den Jahren 1808 bis 1815.
Schließlich raffte eine Seuchte unsern Deilinghofer Ex-Pastor dahin: Johann
Daniel Müller starb im Alter von 52 Jahren am 3.Oktober 1815 - wie das
Langerfelder Kirchenbuch sagt - "als Eigentümer und Gastwirt an der Roten
Ruhr".